Ein Häusle in Cornwall
Roman
Emma, liebenswert, aber ein bisschen zu pflichtbewusst, wird vom Betriebsarzt zu einer kleinen Auszeit verdonnert. Sie landet in Cornwall bei dem verschusselten Aristokraten Sir Nicholas Reginald Fox-Fortescue. Im Land der Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen...
Leider schon ausverkauft
versandkostenfrei
Buch
Fr. 21.90
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnungskauf
- 30 Tage Widerrufsrecht
Produktdetails
Produktinformationen zu „Ein Häusle in Cornwall “
Emma, liebenswert, aber ein bisschen zu pflichtbewusst, wird vom Betriebsarzt zu einer kleinen Auszeit verdonnert. Sie landet in Cornwall bei dem verschusselten Aristokraten Sir Nicholas Reginald Fox-Fortescue. Im Land der Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen erlebt sie ihr blaues Wunder zwischen lauter Exzentrikern und Freigeistern, die nichts von schwäbischer Schaffer-Mentalität halten, in runtergekommenen Häusern leben, auf deren Agenda "Arbeit" gaaanz weit unten steht - und die einen Riesenspaß am Leben haben. Liebe nicht ausgeschlossen ...
Nach den Sensationserfolgen Laugenweckle zum Frühstück, Brezeltango und Spätzleblues der neue Bestseller von Elisabeth Kabatek.
Nach den Sensationserfolgen Laugenweckle zum Frühstück, Brezeltango und Spätzleblues der neue Bestseller von Elisabeth Kabatek.
Klappentext zu „Ein Häusle in Cornwall “
Emma, liebenswert, aber ein bisschen zu pflichtbewusst,wird vom Betriebsarzt zu einer kleinen Auszeit verdonnert.
Sie landet in Cornwall bei dem verschusselten Aristokraten
Sir Nicholas Reginald Fox-Fortescue. Im Land der Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen erlebt sie ihr blaues Wunder zwischen
lauter Exzentrikern und Freigeistern, die nichts von
schwäbischer Schaffer-Mentalität halten, in runtergekommenen
Häusern leben, auf deren Agenda "Arbeit" gaaanz weit unten
steht - und die einen Riesenspass am Leben haben. Liebe
nicht ausgeschlossen ...
Nach den Sensationserfolgen Laugenweckle
zum Frühstück, Brezeltango und Spätzleblues
der neue Bestseller von Elisabeth Kabatek.
Lese-Probe zu „Ein Häusle in Cornwall “
Ein Häusle in Cornwall von Elisabeth Kabatek Prolog
Emma
Bis vor ungefähr 10 000 Jahren gab es Großbritannien nicht. Es gab eine Halbinsel, die am Kontinent klebte. Dann kam die große Eisschmelze. Der Meeresspiegel begann zu steigen.
Vor etwa 8000 Jahren, im Mesolithikum, rollte von Norwegen her einer der gewaltigsten Tsunamis heran, den die Welt je gesehen hatte, und setzte 25 Meilen Festland unter Wasser. Von nun an war Britannien auf der einen Seite, der Kontinent auf der anderen, dazwischen Nordsee und Kanal. Britannien war zur Insel geworden. Vermutlich wird das noch eine ganze Weile so bleiben.
8000 Jahre sind eine lange Zeit, wenn man ungestört ist. Die Briten nutzten sie gründlich. Mit großem Eifer entwickelten sie sich zu Bekloppten, und weil zwischen ihnen und dem Kontinent eine Menge Wasser lag, hinderte sie niemand daran.
Diese Tatsache sollte mein Leben für immer verändern. Oder vielleicht sollte ich besser sagen: Ein einzelner, extrem bekloppter Engländer reichte aus, um mein Leben, das bis dahin von äußerst vernünftigen, berechenbaren, fleißigen Menschen überwiegend schwäbischer Herkunft bevölkert war, für immer zu verändern. Wäre ich bloß nie in das Café gegangen ...
Nicholas
Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass mich das Gespräch mit dem Immobilieninvestor ermüdet und deprimiert hatte. All meine Hoffnungen hatten sich zerschlagen. Am Ende hatten wir höflich Hände geschüttelt, eine elegante Tür hatte sich hinter mir geschlossen, ich hatte den Aufzug ignoriert und stand jetzt etwas benommen in der Fußgängerzone, die sie »Königstraße« nennen. Um mich herum wimmelte es von gutgekleideten Menschen, die seltsame gutturale Laute von sich gaben.
... mehr
Ich lief einfach los, ohne recht zu wissen, wohin. Ich hatte mehr Zeit für die Besprechung eingeplant, der TGV zurück nach Paris ging erst in zweieinhalb Stunden. Sicherlich wäre es ausgesprochen sinnvoll gewesen, eine Ausstellung oder ein Museum zu besuchen, schließlich war ich nie zuvor in Stuttgart gewesen, aber dann sprach mich die Architektur eines Cafés an, das direkt an eine große Kirche angrenzte.
Zögernd setzte ich einen Schritt hinein und blieb neben der Buchhandlung am Eingang stehen, schließlich spreche ich kein Deutsch. Aber dann wurde ich geradezu magisch hineingesogen von der langen Schlange an der Theke und stellte mich instinktiv an. Das Anstehen hatte etwas Beruhigendes, Vertrautes. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass wir Engländer im korrekten Schlangestehen nicht nur ausgesprochen qualifiziert sind, sondern es schon beinahe lieben. Es fällt uns schwer, an einer Schlange vorüberzugehen, selbst wenn sie uns überhaupt nicht betrifft.
Ich zeigte auf einen der appetitlich aussehenden Kuchen, Apfel, wie ich hoffte, dazu bestellte ich auf Englisch einen Kaffee.
»Was für einen Kaffee hätten Sie denn gern?«, antwortete die Bedienung in nahezu fehlerfreiem Englisch und deutete hinter sich an eine Tafel an der Wand. Ich habe den Eindruck, jeder spricht Englisch in diesem Land, es ist beeindruckend und ausgesprochen beschämend für uns. Ich blickte angestrengt auf die Tafel und verstand nichts außer Latte und Cappuccino. »America- no, please«, sagte ich schließlich.
»You Americano?«
»God, no! I'm English. Der Kaffee. Normaler Filterkaffee, bitte, das heißt bei uns Americano.«
Die Frau grinste, nickte, hantierte mit der Maschine, stellte Kaffee und Kuchen auf ein kleines Tablett und deutete auf Milch und Wassergläser neben der Kasse. Ich goss mir ein Glas Wasser ein und sah mich suchend um. In der Mitte des Raums standen die Tische in Reihen nebeneinander, dort gab es einen freien Platz, aber bei uns setzt man sich nicht zu Fremden, und neben der Gruppe junger Frauen mit kleinen Kindern, die kreuz und quer durcheinanderredeten, hätte ich mich auch reichlich deplatziert gefühlt. An einer Wand aus hellen Steinquadern, vermutlich die Kirchenwand, erspähte ich ein freies Stehtischchen mit zwei Barhockern links und rechts und balancierte das Tablett darauf zu, sehr besorgt, ich könnte über einen großen Hund stolpern, der im Weg lag.
So sah ich sie erst, als ich schon fast mit ihr zusammengestoßen war. Wir trafen vor dem Stehtisch aufeinander. Auch sie hielt ein Tablett in den Händen. Und dann blickte ich in diese Augen. Strahlende, smaragdgrüne Augen. Durch die Wand drang Orgelmusik, eine Nonne ging vorüber, und ich stand da wie angewurzelt, ließ beinahe das Tablett fallen, starrte vollkommen hilflos in diese göttlichen Augen und fühlte mich wie der größte Idiot auf Erden. Sie sah mich an, sehr ernsthaft und ein bisschen verwundert. Dann lächelte sie. Sie lächelte, und es war um mich geschehen, sofort. Innerhalb von Sekunden überrollte mich ein Tsunami. Ein Tsunami aus vollkommen überwältigenden, unbekannten Gefühlen, mit denen ich nicht das Geringste anfangen konnte. Ich meine, ich bin Engländer! Wir haben unsere Gefühle gern unter Kontrolle! Mir wurde ganz flau. Ich wollte etwas sagen, brachte aber nur ähnlich gutturale Laute heraus, wie ich sie von den Einheimischen gehört hatte. Ihr Lächeln verwandelte sich in ein Stirnrunzeln. Es war entsetzlich peinlich.
Ich habe die große Befürchtung, dass mein Leben nie wieder so sein wird wie zuvor, und ich bin nicht ganz sicher, ob ich damit klarkomme.
1. Kapitel
Das düstere Herrenhaus
Emma
Es ist einfach unfassbar. Also ehrlich, wofür halten sich die Ärzte heutzutage eigentlich? So schlecht geht es mir nun wirklich nicht. Die Magenschmerzen sind in letzter Zeit schlimmer geworden, das stimmt schon, aber mir deshalb einreden zu wollen, dass ich ein Magengeschwür kriege, wenn ich nicht aufpasse, das ist doch völlig übertrieben, davon bin ich ja nun wirklich weit entfernt. Reine Panikmache! Ich kenne meinen Körper schließlich besser als irgendein Betriebsarzt, der mich zwei-, dreimal gesehen hat und sich wichtigmachen will. Ich arbeite seit Jahren mit Stress, und mein Körper hat's immer ausgehalten. Und im Moment geht es nun mal besonders hektisch zu, das liegt am Projekt und wird sich auch wieder ändern. Ich muss weiter darum kämpfen, dass jemand eingestellt wird, der mir zuarbeitet.
Das dauernde Augenlidzucken ist lästig, weil man es sieht. Bis her hat mich aber noch niemand drauf angesprochen. Was man zum Glück nicht sieht, sind die Schlafstörungen. Die nerven wirklich. Deswegen bin ich ja auch zum Betriebsarzt. Die Firma leistet sich so was, immerhin. Ich wollte wirklich nur, dass er mir ein paar vernünftige Schlaftabletten verschreibt, mit möglichst viel Chemie drin, nicht so einen Baldriankram für esoterische Weicheier. Ich will einfach mal wieder am Stück durchpennen! Erst kann ich nicht einschlafen, obwohl ich hundemüde bin, und dann bin ich nach zwei Stunden wieder hellwach, und mir fällt irgendwas ein, was ich dringend erledigen muss. Ich versuche, nicht an die Arbeit zu denken, aber das geht nicht so einfach auf Knopfdruck, und je näher der Morgen rückt, desto öfter wache ich auf, manchmal habe ich fast das Gefühl, ich liege mehr wach, als dass ich schlafe, und bin beinahe froh, wenn der Wecker endlich klingelt und die Quälerei ein Ende hat. Ich fühle mich oft wie gerädert, aber mit starkem Kaffee, Guarana und Red Bull komme ich schon halbwegs durch den Tag. Außerdem habe ich so viel zu tun, dass ich keine Zeit habe, darüber nachzudenken, ob ich müde bin oder nicht.
Die Schwindelanfälle allerdings sind neu. Einmal bin ich sogar umgekippt. Zum Glück war ich grad allein, und keiner hat es mitgekriegt. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Ich hab mir den Arm an der Heizung angeschlagen, aber sonst ist weiter nichts passiert, und nachdem ich ein paar Gläser Wasser getrunken habe, konnte ich eigentlich fast normal weiterarbeiten. Vielleicht sollte ich mal ein Blutbild machen lassen. Ist bestimmt irgendein Vitaminmangel. Oder Eisen, das fehlt Frauen doch eigentlich immer.
Als der Arzt dann drauf bestand, meinen Blutdruck zu messen und ein EKG zu machen, nur wegen ein paar blöder Tabletten, die man nicht rezeptfrei kriegt, und schließlich mit Burn-out anfing, hab ich ihn zunächst völlig schockiert angestarrt. Zunächst. Dann fing ich an zu lachen. Weil, es ist einfach absolut lächerlich. Heutzutage ist doch alles Burn-out! Die Modekrankheit für alle Gelegenheiten! Sonst müsste man sich ja Gedanken über eine Diagnose machen. Außerdem, soweit ich weiß, ist Burn-out eine Form von Depression. Ich bin nicht depressiv. Nicht im Geringsten. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wir hatten mal einen Projektleiter, der hatte wirklich Burn-out. Der lag wochenlang nur im Bett und hat an die Decke gestarrt. Er kam dann wieder und hat kurz drauf gekündigt. Weil er den Termindruck nicht aushält, hat er gesagt, und ihm seine Gesundheit und seine Familie wichtiger ist. Aber ich, ich liege nicht im Bett! Ich mache meinen Job. Burn-out ist was für Versager.
»Ich schreibe Sie jetzt für zwei Wochen krank«, sagte der Arzt.
»Ich bin nicht krank!«, habe ich ihn angeschnauzt. »Und im Moment kann ich mir nicht einmal einen einzigen Tag Krankschreibung erlauben! Sie wissen genau, in welchem Projekt ich stecke, bis zum Hals, und welche Bedeutung es für uns hat!«
Er guckte mich sehr streng an und sagte scharf: »Ich sage Ihnen jetzt mal was. Wann haben Sie das letzte Mal in den Spiegel gesehen? Sie sehen aus wie ein Gespenst. Wenn Sie jetzt nicht die Notbremse ziehen, landen Sie in der Klinik. Und glauben Sie mir, das dauert dann viel, viel länger als nur zwei Wochen. Wenn Ihnen das lieber ist, dann machen Sie einfach so weiter.« Da wurde mir dann doch ein bisschen mulmig.
»Wie viel Stunden arbeiten Sie in der Woche?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. »Also, normalerweise allerhöchstens sechzig, in nächster Zeit wird's wohl ein bisschen mehr werden, wegen dem Projekt.« Er sah mich entgeistert an. »In fünf Tagen arbeiten Sie sechzig Stunden?«
»Nein. In sechs Tagen. Zehn Stunden am Tag, so wild ist das doch nicht, oder? Da hat man immer noch 14 Stunden am Tag für Essen, Schlafen, Facebook, Fernsehen und iPhone. Das ist mehr als die Hälfte! Und den kompletten Sonntag sowieso. Also, mir reicht das. Früher haben die Leute ja viel mehr gearbeitet. Da gab es den Begriff Freizeit gar nicht.« Und am Sonntagabend war ich meistens richtig froh, dass ich am nächsten Tag wieder arbeiten gehen konnte, aber das sagte ich ihm nicht.
»Und was machen Sie zur Erholung? Sport, Hobbys, Freunde treffen?«
»Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio in der Mittagspause«, log ich. »Und ich habe eine sehr gute Freundin, keine Sorge, und eine Kollegin, mit der ich mittags ab und zu essen gehe, ich habe keine Sozialphobie.« Okay, zu der Kollegin unterhielt ich mehr so eine strategische Beziehung, sie war die Sekretärin von einem der Chefs. Julia, die Freundin, war dafür echt. Sonntags war sie meist mit ihrer Familie beschäftigt, aber wir gingen mindestens einmal die Woche nach der Arbeit zusammen was trinken oder ins Kino. Der Arzt guckte mich immer noch total intensiv an. Langsam ging er mir auf die Nerven, mit seiner Nickelbrille und dem grauen Haar. Bestimmt hatte ihm die Pharmaindustrie ein teures Wochenende im Luxushotel finanziert, »Früherkennung von Burnout «, und jetzt sollte er als kleinen Dank ein paar Medikamente ausprobieren. Oder machte er einen auf Apotheken-Umschau, »Ich bin Arzt - mit Gewissen!«. Er schob mir dann die Krankschreibung über den Tisch und lehnte sich zu mir herüber.
»Hören Sie«, sagte er leise und eindringlich, so, als hätte er die Befürchtung, dass irgendjemand heimlich mithörte. Dabei war die Tür zu. Der Mann litt unter Verfolgungswahn, ganz klar. »Ich rate Ihnen: Klinken Sie sich zwei Wochen aus. Machen Sie Spaziergänge an den Bärenseen. Legen Sie sich im Mineralbad Leuze in die Sauna. Schlafen Sie sich aus. Wenn Sie hier zusammenklappen, keiner wird es Ihnen danken. Irgendwann fliegen Sie unter einem Vorwand raus. Dann macht jemand anders Ihren Job. Niemand ist unersetzlich. Vor allem, wenn das Projekt doch noch kippt ...«
Als ob ich das nicht wüsste! Das Gesülze hätt er sich echt sparen können. Ich weiß, dass es genug Leute gibt, die mich gern abschießen würden. In einer Männerdomäne arbeitet man doppelt so hart wie die Kerls. Trotzdem: Ich mache meinen Job, weil ich ihn gern mache. Vielleicht auch ein klitzekleines bisschen, um den Männern zu beweisen, dass ich in einem Männerjob meine Frau stehe, aber das ist nicht der Hauptgrund. Arbeit ist nun mal das Wichtigste im Leben, und ich habe das Riesenglück, dass ich einen Job habe, der wirklich toll ist. Aber das kann sich so ein armseliger Betriebsarzt, der es bestimmt kaum erwarten kann, in Rente zu gehen, natürlich nicht vorstellen. Trotzdem steckte ich die Krankmeldung ein.
Ich blieb einen Moment im Flur stehen und holte tief Luft. Erst jetzt merkte ich, dass er mir kein Schlaftablettenrezept gegeben hatte, der Arsch. Ich war kurz davor, wütend gegen seine Tür zu hämmern. Dreh jetzt nicht durch, Emma, beschwor ich mich selber. Schlaf dich ein, zwei Tage aus, dann kommst du wieder und machst einen auf Superheldin, die sich trotz Krankheit pflichtbewusst zur Arbeit schleppt. Ich ging zurück in mein Büro, setzte mich an meinen Schreibtisch und checkte meinen Posteingang. Eine Erinnerung, elf neue Mails, zwei davon waren mit »Wichtigkeit - hoch« gekennzeichnet. Um mich herum war alles verlassen. Mittagspause. Die Chefs saßen beim Edelitaliener in der Türlenstraße und hatten mich eigentlich dabeihaben wollen, damit ich sie zwischen Antipasti und Tiramisu über den Stand des Projekts informierte. Ich hatte einen seit Tagen vereinbarten Telefontermin vorgeschoben und versprochen, so schnell wie möglich nachzukommen. Ich stand auf und starrte durch die riesigen Glasfenster hinaus auf die Baustelle. Im Sonnenschein sah sie nicht so schlimm aus wie sonst. Mein Telefon klingelte. Wenn ich jetzt einfach ohne Erklärung verschwand, würden die wildesten Spekulationen ins Kraut schießen. Schwangerschaft bestimmt nicht, weil »Die will doch sowieso koinr«, aber was Psychisches, sofort. Am besten kurz aufs Handy anrufen, Migräne vortäuschen. Aber bei Migräne würden sie sich das Maul zerreißen, ist doch typisch, Frauen sind halt nicht belastbar, und wenn's wirklich drauf ankommt, kriegen sie Migräne, und wer kümmert sich jetzt ums Projekt? Darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Und für Migräne kriegte man auch keine Krankschreibung über zwei Wochen. Blieb die Variante: ehrlich sein. Ach, übrigens, ich wollte nur kurz Bescheid geben, ich bin krankgeschrieben, Burn-out- Gefahr, ist aber nicht weiter dramatisch. Da konnte ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln! Ganz nach oben auf die Abschussliste! Plötzlich war mir alles egal. Ich war niemandem eine Erklärung schuldig. Ich sagte meine Teilnahme für die Besprechung am Nachmittag ab, schickte eine Mail an alle drei Chefs und an Petra vom Personal, dass ich für zwei Wochen krankgeschrieben war, aber nicht vorhatte, die volle Zeit in Anspruch zu nehmen, stellte das Diensthandy ab und ließ es deutlich sichtbar auf dem Schreibtisch liegen. Dann schickte ich Julia eine kurze Nachricht, aber die war sowieso mit der Familie in Urlaub. Die letzte Mail schickte ich an Melli und löschte dann die privaten Mails aus dem »Gesendet«-Ordner. Für alle Fälle, denn ich traute hier niemandem. Ich fuhr den PC herunter und stellte das Telefon um. Es klingelte wieder, und auf dem Display erschien eine Handynummer. Die Chefs hatten meine Mail gelesen. Ich packte hastig meine Sachen zusammen, stopfte die Krankmeldung in einen Umschlag, warf sie beim Hinausgehen in Petras Postkörbchen und machte, dass ich zur Tür rauskam. Petra konnte mich noch nie leiden.
Der Pförtner winkte mir erstaunt zu, als ich das Gebäude verließ. Er sah mich sonst nur morgens, es sei denn, ich hatte einen Termin außer Haus oder musste zur Baustelle. Meist kamen die Termine jedoch zu mir. Wenn ich abends ging, war der Pförtner normalerweise seit Stunden im Feierabend. Mittags ging ich nur selten vor die Tür, aß meist am Schreibtisch ein belegtes Brot und arbeitete dabei weiter. Jetzt lief ich einfach los, ohne recht zu wissen, wohin. Es gab sowieso nur eine Richtung, in die man vernünftig gehen konnte, am Hauptbahnhof vorbei in die Königstraße. Weit war das nicht, aber es dauerte, weil ich wegen der vielen Baustellen überall Umwege laufen musste. Die Königstraße war total voll. Meine Güte, wie viele Leute in meinem Alter es gab, die mittags mit Einkaufstüten in der Hand über die Königstraße schlenderten, schon am Anfang der Woche, als hätten sie nichts zu tun! Von was lebten die? Hatten die keinen Job? Aber wieso konnten die sich dann einen Stadtbummel leisten? Ich war seit Monaten nicht in der Innenstadt gewesen, schon gar nicht tagsüber. Normalerweise kaufte ich abends auf den letzten Drücker beim Gemüsetürken ein. Ich fühlte mich ein bisschen verloren, fast so, als würde man mir ansehen, dass ich eigentlich kein Recht hatte, hier zu sein. Dass ich eigentlich an meinem Schreibtisch sitzen müsste, Telefonate führen, Mails schreiben, Besprechungen moderieren, am besten alles gleichzeitig. An meinem Schreibtisch fühlte ich mich sicher. Dort war mein eigentliches Zuhause.
Obwohl ich keine Eile hatte, war ich von ganz alleine in meinen üblichen Stechschritt gefallen. Ich laufe nie langsam, man verliert zu viel Zeit dabei, und das entspricht mir nicht. Kaffee, sagte ich mir. Du solltest ganz entspannt einen Kaffee trinken gehen, wie eine Art Übergangsritual, und damit deine zwei freien Tage einläuten. Wenn du jetzt nach Hause gehst, weißt du sowieso nichts mit dir anzufangen. Da ich gerade auf der Höhe des Hauses der Katholischen Kirche war, das ein Café beherbergt, ging ich hinein.
Ich stellte mich in die Schlange und holte mir einen Milchkaffee und nach kurzem Kampf mit mir selbst ein Stück Käsekuchen. Auch hier war es voll. Offensichtlich gab es zu viele Menschen, die genug Zeit und Geld hatten, um unter der Woche entspannt in einem Café abzuhängen, so, als gäbe es keine Arbeit, keine Pflichten, kein Morgen. Zielstrebig steuerte ich einen freien Stehtisch an. Von der anderen Seite näherte sich ein Typ, der es offensichtlich auf den gleichen Tisch abgesehen hatte, und ich dachte nur: Junge, leg dich bloß nicht mit mir an. Ich bin extrem schlecht gelaunt, das ist mein Platz, und ich habe nicht vor, ihn mit dir zu teilen, auch wenn da zwei Hocker sind, ist das klar? Der Mann blieb stehen und starrte mich an, als sei ich eine Erscheinung. Irgendetwas an ihm rührte mich. Vielleicht, dass er ein bisschen tollpatschig wirkte, wie er da mit seinem Tablett in der Hand beinahe über einen Hund stolperte. Außerdem sah er trotz seines zerzauselten Haars und des Cordjacketts, das von meinem Großvater hätte stammen können, ziemlich attraktiv aus. Groß, schlank, fast schlaksig. Nicht, dass er mich besonders beeindruckte, Männer wurden völlig überbewertet, aber schon fast gegen meinen Willen musste ich grinsen.
Er kam zögernd näher. Dann gab er ein paar ziemlich seltsame Geräusche von sich, und für einen Moment dachte ich, er sei durchgeknallt. »Good afternoon«, sagte er endlich mit einem sehr britischen Akzent. Mehr nicht. Er stand da und starrte mich an, und ich dachte nur, ein blöder Brite, ausgerechnet. Ich mag keine Briten! Amis, ja, ich war mal ein Jahr an einer amerikanischen Highschool, aber keine Briten. Er fragte nicht, ob er den freien Stuhl haben könnte. Er stand nur da und sah schräg nach unten, so, als säße unter dem Tisch ein wildes Tier, vor dem er sich fürchtete. Ich saß schon auf meinem Stuhl, das Tablett vor mir. »Sit down«, sagte ich knapp. Das reichte ja wohl. Ich hatte nicht vor, mich mit ihm zu unterhalten. Er gehorchte und starrte mich wieder an.
»Thank you«, sagte er. »Thank you very much indeed. That's very kind. Lovely day, isn't it?«
Ich stöhnte innerlich. Halt bloß die Klappe, dachte ich. Ich hab dir einen Stuhl angeboten. Das reicht doch wohl, oder? Ich will kein Gespräch mit dir anfangen, schon gar nicht, wenn du so ein blasiertes England-Englisch redest und mit Höflichkeitsformeln um dich schmeißt. Ich will in aller Ruhe darüber nachdenken, wie beschissen das Leben ist. Und schon gar nicht will ich mit dir übers Wetter reden. Wir sind in Stuttgart, es ist Juni, der Sommer hat angefangen, es ist grauenhaft schwül, wahrscheinlich wird's noch gewittern, und es ist mir scheißegal, weil die Sommer in Stuttgart jedes Jahr so sind. Noch immer sah er mich an und lächelte erwartungsvoll, ganz so, als würde es ihm nichts ausmachen, fünf oder zehn Minuten oder gar eine Stunde auf meine Antwort zu warten.
»No, it's not a lovely day«, sagte ich schließlich, so unfreundlich ich nur konnte, und deutlich lauter, als es nötig gewesen wäre, senkte den Blick wütend auf meine Kaffeetasse und hoffte, ihn damit endgültig zum Schweigen gebracht zu haben.
»Oh«, entgegnete er schließlich. Ich sah nicht auf.
Und dann, noch einmal, »Oh«. Dann sagte er nichts mehr. Na also. Ich schielte auf seine Tasse. Er rührte darin herum und trank noch immer nicht. Hurra, dachte ich erleichtert. Er hat's kapiert. Vorsichtig guckte ich hoch. Er sah mich an. »I'm sorry«, sagte er, ganz leise, und in seinem Blick lag so viel Anteilnahme und Wärme, dass etwas in mir platzte, und plötzlich, ganz gegen meinen Willen, brach ich in Tränen aus.
Emma
Der Flughafen in Newquay war winzig. Zu winzig offensichtlich für Gepäck. Mein Koffer war jedenfalls nicht im Flieger, sondern bei meinem Zwischenstopp auf dem Flughafen London-Gatwick hängengeblieben.
»I'm sorry«, sagte Nicholas, als sei es seine Schuld. Er füllte beim Lost & Found das Formular für mich aus, gab seine Handynummer an und betonte mehrmals, man möge den Koffer sofort bringen lassen, wenn das nächste Flugzeug aus London kam. Ich war es nicht gewohnt, dass jemand etwas für mich erledigte. Es war mir total unangenehm.
Ich bin kein Mensch, der leicht ins Schwärmen gerät, aber der Landeanflug war unglaublich gewesen. Ich hatte einen Fensterplatz, das Wetter war fantastisch, die Sonne ging gerade glutrot unter, und wir flogen das letzte Stück entlang der Küstenlinie, erst waren da schroffe Felsen und dann ein endloser, nahezu menschenleerer Sandstrand, und Schaumkronen auf dem Meer, und ein paar schwarze Punkte, die im Wasser tanzten, wahrscheinlich Surfer. Das war also Cornwall.
Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt, man hätte fast meinen können, man sei irgendwo im Süden, am Mittelmeer. Ich blickte hinaus, war völlig fasziniert, und plötzlich war da dieses komische Gefühl. Normalerweise ignoriere ich meine Gefühle, aber jetzt überrollte mich eine Welle, sie riss mich mit sich, und ich war ihr hilflos ausgeliefert. Es fühlte sich an wie eine Traurigkeit, oder wie die Sehnsucht, die mich manchmal an einem der ersten warmen Abende im Frühling überkam, wenn die Natur explodierte und die Vögel sangen wie verrückt. Ich weiß nicht genau, was es war, und ich wollte es auch gar nicht wissen, es war fast wie ein Schmerz und fühlte sich so unangenehm an, dass ich es sofort wegschob. Gefühle konnte ich jetzt echt nicht brauchen. Ich wollte mich erholen! Zurück blieb eine leichte Unruhe. Ich bin eigentlich nicht so der nervöse Typ, aber ich konnte es immer noch nicht fassen, dass ich einfach abgehauen war. Ohne irgendjemandem was zu sagen außer Melli, Julia, meiner Mutter, dem Aboservice der Stuttgarter Zeitung und meiner Nachbarin, mit der ich die Kehrwoche getauscht hatte, falls ich je bis Samstag nicht zurück war. Bloß nicht drüber nachdenken, wie verrückt das war! Genauso verrückt wie die Tatsache, dass ich mich mit einem Mann treffen würde, den ich überhaupt nicht kannte. Nicht nur treffen, sondern sogar bei ihm wohnen! Das konnte ja ganz schnell saumäßig peinlich werden. Es war dann aber völlig cool. Nicholas gab mir höflich die Hand und lächelte, sehr freundlich und sehr distanziert. Bei dem muss man sich echt keine Sorgen machen, dass er nachts über einen herfällt! Wahrscheinlich ist er schwul und hat mich nur eingeladen, weil er Mitleid mit mir hatte, im Café, als ich anfing zu heulen. Männer sind ja immer total beeindruckt, wenn Frauen heulen. Viele Frauen flennen absichtlich, wenn sie was erreichen wollen. Ich nicht. Ich find's vor allem peinlich.
Als wir zum Auto gingen, das einzige, das noch auf dem Parkplatz stand, wegen der Koffergeschichte, zog sich der Himmel plötzlich mit schwarzen Wolken zu, in Sekundenschnelle, wie mir schien. Die ersten Tropfen fielen, und ich rannte die letzten Meter zum Auto, weil meine Jacke war ja im Koffer, und ich trug nur ein dünnes Sommerkleid, das blöderweise auch noch den Fettring auf meinen Hüften betonte, und wenn's nass wurde, erst recht. Nicholas trat neben mich und sagte todernst: »Willst du fahren?«, und erst da merkte ich, dass ich auf der Fahrerseite stand. Kaum saßen wir im Auto, fing es an, wie aus Kübeln zu schütten.
»He, grad eben hat doch noch die Sonne geschienen!«, protestierte ich.
Nicholas lachte. »Es tut mir wirklich leid, aber plötzliche Wetterumschwünge sind hier ziemlich normal. Du solltest immer etwas gegen den Regen dabeihaben, selbst wenn keine Wolke am Himmel ist. Wenn es regnet, wird es auch ziemlich schnell kalt, du solltest also auch immer etwas Warmes dabeihaben. Da der Regen oft von Sturmböen begleitet wird, vor allem, wenn er überraschend vom Meer her kommt, solltest du immer auch etwas gegen den Wind dabeihaben. Am besten hast du immer alles dabei. Auch Badesachen, denn es könnte auch ganz plötzlich wieder aufklaren.«
Na großartig, dachte ich. Ich trage Sommerklamotten, weil ich dachte, ich mache Sommerurlaub, es schüttet, und mein Koffer hängt in London, und selbst in diesem Koffer befindet sich nur eine sehr überschaubare Anzahl von Klamotten gegen Regen, Kälte und Wind, weil ich ja dachte, ich mache Sommerurlaub. Immerhin hatte Nicholas Badesachen erwähnt. »Wie viel Grad hat das Wasser denn so?«
»Ach, im Juni in der Regel so um die 16 Grad.«
Das waren nur vier Grad weniger als die Kaltbadehalle im Leuze und klang nach einem fantastischen Badeurlaub. Am besten sollte ich wohl auch immer eine Wollmütze dabeihaben.
»Dieses Jahr allerdings war das Frühjahr so kalt, da hat es wohl nur 14 Grad, schätze ich«, fuhr Nicholas erbarmungslos fort. »Entschuldige bitte das Auto. Es gehörte meinem Vater und ist etwas klapprig.« Das war eine ziemliche Untertreibung. Die Karre quietschte und ächzte, auf meiner Seite regnete es herein, weil das Fenster nicht richtig zuging, und es roch penetrant nach Pferd und Hund. »Wie lange brauchen wir ungefähr?«, fragte ich.
»Normalerweise nicht einmal eine halbe Stunde. Aber bei dem Wetter ...« Nicholas starrte angestrengt auf die Straße. Es schüttete jetzt so stark, dass er nur langsam fahren konnte. Außerdem war es ganz schnell zappenduster geworden. »Ich hoffe sehr, du verzeihst mir, dass ich mich für die Dauer der Fahrt nicht mit dir unterhalte«, sagte Nicholas. »Aber ich bin leider etwas aus der Übung und muss mich auf das Fahren konzentrieren. In Paris hatte ich kein Auto.«
»Aber natürlich verzeihe ich dir«, sagte ich und versuchte nachzurechnen, wie oft Nicholas sich schon entschuldigt hatte, seit ich angekommen war. Er redete auch immer so gestelzt. Wie aus einem Film entsprungen, Stolz und Vorurteil oder so. Wahrscheinlich waren die Engländer einfach förmlicher als die Amis. Wir fuhren schweigend durch den prasselnden Regen. Es ging ziemlich viel rauf und runter und um irgendwelche Kurven, aber erkennen konnte ich praktisch nichts.
Irgendwann krachten wir beinahe in ein Gatter. »Bloody hell!«, entfuhr es Nicholas, um sich gleich darauf wieder wortreich zu entschuldigen, dabei machte ihn das Fluchen direkt mal etwas weniger distanziert. Er setzte ein Stück zurück, sprang hinaus in den Regen und machte sich an dem Gatter zu schaffen. Es schwang von alleine auf, während er zurück zum Auto rannte. Kies knirschte unter den Reifen. Hatte das Häusle etwa eine private Zufahrt? Beleuchtung gab es keine. Ich erkannte nur ein paar hohe Bäume, dann fuhr Nicholas um eine Kurve und hielt an. »Da sind wir«, sagte er feierlich. »Herzlich willkommen in Fox Hall.« Fox Hall? Ich stieg aus und stand vor meinem leicht frustriert wirkenden Gastgeber, der wie ein Hase ums Auto herumgerannt war, um mir die Wagentür zu öffnen. Äh - was hatte er gesagt? »Das Haus ist nicht unbedingt klein.« Okay, was stellt man sich da so vor? Ein etwas größeres Einfamilienhaus, vielleicht? Mit ein bisschen Gärtle drum rum und einer Garage, möglicherweise sogar einer Doppelgarage, so, wie man im Remstal gerne wohnte? Es lebe das britische Understatement! Auch wenn ich in der Dunkelheit und dem strömenden Regen nicht viel erkennen konnte - hier stand ich, fernab jeglicher Zivilisation, vor einem gigantischen, düsteren Schuppen, der offensichtlich schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hatte. Eine große Freitreppe führte hinauf zum Eingang, der sich hinter einer Reihe vorgesetzter Säulen verbarg. Ich stand nur da und starrte.
»Komm«, sagte Nicholas neben mir sanft. »Du wirst ja ganz nass.« Plötzlich lief mir ein Schauer über den Rücken.
Nicholas
Emma schläft jetzt seit gut zehn Stunden. Die Arme scheint furchtbar erschöpft zu sein. Vor einer guten Stunde stand ich an ihrer Zimmertür und lauschte; nicht das leiseste Geräusch war zu hören. Nun, das ist ein gutes Zeichen. Schließlich ist sie her gekommen, um sich zu erholen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie hier ist! Was ich am allerwenigsten fassen kann, ist, dass ich es gewagt habe, sie nach Fox Hall einzuladen. Normalerweise bin ich entsetzlich schüchtern, wenn es um Frauen geht, aber Emma löst weiterhin die erstaunlichsten Gefühle in mir aus. Als sie mir gestern auf dem Flughafen entgegenkam, in diesem entzückenden Sommerkleid, das so hübsch auf ihren Hüften lag, verspürte ich den völlig irrationalen Wunsch, auf sie zuzurennen, sie in meine Arme zu reißen und bis zur Besinnungslosigkeit zu küssen. Mir brach am ganzen Körper der Schweiß aus, aber in Eton habe ich Selbstbeherrschung gelernt, und ich hoffe sehr, sie hat es nicht gemerkt. Eigentlich sollte ich über meinen Papieren sitzen, aber ich bin zu nervös. Außerdem ärgere ich mich über den Earl. Bestimmt ist er eifersüchtig und hat deswegen das Tor zugemacht. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit ihm reden müssen, aber er lässt sich nicht blicken. Ich muss unter allen Umständen verhindern, dass Emma den Earl kennenlernt.
Ich werde mit den Frühstücksvorbereitungen beginnen, das wird mich beruhigen. Irgendwann wird Emma ja aufstehen und sicher schrecklichen Hunger haben; gestern Abend war sie völlig entkräftet und wollte gleich zu Bett gehen. Ich lobe mich selber nur ungern, aber mein Full English Breakfast gehört mit zum Besten, was man in Cornwall in Sachen Frühstück bekommen kann. Das liegt bei uns in der Tradition der Familie, und zwar in der männlichen Linie. Das Frühstück meines Vaters war legendär. Sollte ich einmal einen Sohn haben, wonach es im Augenblick nicht aussieht, so hoffe ich, dass er sich ebenfalls für die Kunst des Frühstückmachens interessiert. Der einzige Unterschied zwischen dem Full English Breakfast meines Vaters und meinem Full English Breakfast besteht darin, dass ich die Würstchen weglasse. Und den Black Pudding. Für manche Leute ist es dann nicht mehr wirklich full. Aber Emma achtet sicher auf ihre Linie und legt keinen Wert auf fettige Würstchen und gebackenes Schweineblut. Nicht, dass sie es sich nicht erlauben könnte, so fantastisch, wie sie aussieht. Dabei könnte ich nicht einmal genau sagen, was es ist, was sie so fantastisch macht. Ich meine, als ich sie zum ersten Mal in dem Café in Stuttgart sah, trug sie einen ziemlich langweiligen schwarzen Hosenanzug, wie ihn Hunderte von Frauen im Londoner Bankenviertel tragen. Und doch hätte ich sie niemals für eine Engländerin gehalten. Zum einen ist sie nicht so ein Hungerhaken wie viele Businessfrauen in London, die meinen, sie müssten in die gleiche Kleidergröße passen wie unsere magersüchtige Herzogin. Nein, sie hat Rundungen, aber die Rundungen sind auch nicht zu rund und genau da, wo sie hingehören. Sie wirkte insgesamt sehr gepflegt und war auch eher dezent geschminkt, während sich viele Engländerinnen mit Make-up zukleistern, weil sie sich zu häufig betrinken und Alkohol im Gesicht seine Spuren hinterlässt und sie trug flache Pumps, nicht so hochhackige Schuhe, in denen die Engländerinnen selbst bei Schnee ohne Seidenstrümpfe herumwackeln, weil sich die Anschaffung der Schuhe nicht lohnen würde, wenn sie auf gutes Wetter warteten.
Ich schätze jedoch, das Beste an Emma sind ihre Haare. Obwohl sie sich offensichtlich große Mühe gibt, sehr ordentlich auszusehen, scheinen die Haare nicht ordentlich sein zu wollen. Sie sind kurz und blond und wuschelig und stehen ziemlich wild in alle Richtungen ab. Die Haare erinnern mich sogar fast ein bisschen an Meg Ryan in Stadt der Engel. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn bestimmt schon neunmal gesehen, immer alleine, und jedes Mal heule ich am Ende, wenn Meggie, frisch vom Lkw überfahren, in den Armen von Seth stirbt, obwohl das mit dem Heulen natürlich ausgesprochen unmännlich ist. Deswegen würde ich den Film auch niemals in Begleitung anschauen. Dann würde es heißen, ich sei schwul. Ich könnte mich nirgends mehr blicken lassen, vor allem nicht im Pub. Im Pub muss ein Mann ein echter Mann sein, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, an das auch ich mich halte.
Emma brach in Stuttgart im Café ebenfalls in Tränen aus. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie normalerweise nicht weint. Es war ihr nämlich offensichtlich schrecklich peinlich. Mir war es auch schrecklich peinlich, aber ich ließ es mir nicht anmerken und wartete einfach ab.
»Ich habe ein Problem«, flüsterte sie schließlich. »Houston, we've got a problem«, dachte ich automatisch. Ihr Englisch war sehr amerikanisch, ansonsten aber hervorragend.
»Das tut mir ausgesprochen leid«, sagte ich, so höflich ich nur konnte. Höflichkeit ist das beste Mittel, wenn Leute dabei sind, die Nerven zu verlieren. Ich wollte auf keinen Fall, dass dieses entzückende Wesen die Nerven verlor, aus dem Café stürzte und ich es nie mehr wiedersah. »Wenn Sie mir gerne sagen möchten, worum es in diesem Problem geht, obwohl man ehrlicherweise zugeben muss, dass wir uns im Prinzip überhaupt nicht kennen, dann würde ich das nicht seltsam finden. Ich heiße übrigens Nicholas. «
»Emma«, flüsterte sie. »Burn-out.«
»Emma. Was für ein hübscher Name. Burn-out. Wie ausgesprochen interessant.«
»Interessant?«, rief sie und schien verärgert zu sein.
»Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was Burn-out ist«, sagte ich entschuldigend.
»Das ist Englisch!«, rief sie aus.
»Das dachte ich mir. ›Handy‹ scheint auch Englisch zu sein. Trotzdem versteht es bei uns niemand. Wir sagen ›Mobile phone‹.«
»Ach«, murmelte sie und schwieg. Immerhin schien sie sich ein wenig gefangen zu haben.
»Ich arbeite für ein großes Ingenieursbüro«, sagte sie schließlich. »Ich koordiniere ein Projekt. Ein sehr kompliziertes Projekt. Es ist ein Projekt, das die Stadt komplett revolutionieren wird, eine Wahnsinns-Chance für die Zukunft. Der Bahnhof wird unter die Erde gelegt. Das spart Fahrzeit, schafft eine faszinierende neue Infrastruktur. An unser Büro sind einige der zentralen Bauvorhaben vergeben worden.«
Sie klang jetzt so, als träte sie im Fernsehen bei einer Talkshow auf. Ich muss sagen, ich war beeindruckt.
»Leider ist es auch ein Projekt, bei dem ständig was schiefgeht. Ich bin für einen Teilbereich verantwortlich. Bei mir laufen alle Fäden zusammen. Ich überwache den Stand der Bauarbeiten, die Termine, das Geld. Es ist ein Traum- und ein Horrorjob gleichzeitig. Ich arbeite wie eine Verrückte, aber es geht unheimlich viel schief. Alle wissen, dass der Zeitplan ein völliger Wahnsinn ist. Niemand hält die Termine ein, weil sie gar nicht zu halten sind, und ich bin diejenige, die es ausbadet. Und das Geld ist viel zu knapp kalkuliert. Außerdem haben wir nicht genug gute Leute. Ich schlafe kaum noch. Der Arzt sagt, ich sei krank, und kriege Burn-out. Das ist eine Erschöpfungskrankheit. Wenn es jemanden wirklich schlimm erwischt, fällt er Monate aus. Das kann ich mir nicht leisten. Er hat mich krankgeschrieben, für zwei Wochen. Deswegen sitz ich jetzt hier und nicht in meinem Büro. Ich hab vor, zwei Tage daheimzubleiben, und dann gehe ich wieder arbeiten.« Sie hatte geredet ohne Punkt und Komma. Wir schwiegen beide.
»Komm mit mir nach Cornwall«, platzte ich heraus und wimmerte gleichzeitig innerlich, fabelhaft, Nicholas, das hast du ja wirklich geschickt eingefädelt.
»Wie bitte?«
»Ich fahre in zwei Stunden mit dem TGV nach Paris und hole meine Koffer ab, ich habe dort gelebt, dann geht's gleich weiter nach London und Cornwall. Ich habe ein Haus geerbt. Mein Vater ist kürzlich verstorben. Das Haus ist nicht gerade im besten Zustand, das solltest du wissen, aber es ist nicht unbedingt klein. Ich muss mich darum kümmern und werde nicht allzu viel Zeit haben, aber ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass Cornwall ein ausgesprochen geeigneter Ort ist, um sich zu erholen. Man kann sehr schön auf dem Küstenpfad spazieren gehen, die Luft ist gut, und die Menschen sind sehr freundlich.« Während ich das sagte, genauso ohne Punkt und Komma wie Emma, tobte ein hässliches kleines Männlein durch meinen Kopf und schrie: »Du bist völlig verrückt, Nicholas! Du kennst diese Frau überhaupt nicht! Dein Haus ist die größte Bruchbude an der ganzen Nordküste! Du bist pleite! Was, wenn es zwei Wochen am Stück stürmt? Es regnet durchs Dach, und man hat dir die Heizung abgestellt! Meinst du, es ist so eine Art Schicksal, dass du diese Frau getroffen hast? Sie passt überhaupt nicht zu dir!«
Felicity hatte immer gesagt, ich sei ein hoffnungsloser Romantiker.
Während das Männlein in mir tobte und ich nach außen krampfhaft weiterlächelte, sah Emma mich ungläubig an. Und dann lachte sie. Es brach aus ihr heraus, vollkommen ungekünstelt, sehr vergnügt, erstaunlich laut und schon fast ein bisschen ordinär. Für uns in England, jedenfalls, wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Es haute mich um. Es fühlte sich an, als sei ich gerade gegen einen Pfosten gerannt und hätte für ein paar Sekunden das Bewusstsein verloren. Sie musste es mir angesehen haben, denn sie fragte mich, ob alles okay sei. Ich schluckte und sagte hastig: »Natürlich. Alles okay.« Aber nach diesem Lachen wusste ich: Ich hatte genau das Richtige getan.
»Cornwall«, sagte sie. »Aha. So Rosamunde-Pilcher-mäßig?«
»Rosamunde wer?«
»Nicht so wichtig. Und du lädst mich also ein, obwohl du mich überhaupt nicht kennst? Du weißt doch gar nicht, ob ich dir auf die Nerven gehe! Und ich soll in zwei Stunden in einen Zug steigen? «
»Es gibt genügend Platz, und du wirst dich sowieso überwiegend selber beschäftigen müssen. Und natürlich sollst du nicht in zwei Stunden in einen Zug steigen, sondern mit dem Flugzeug nachkommen, morgen vielleicht. Du könntest nach Newquay fliegen, das ist nicht weit. Dort könnte ich dich abholen.«
»Das ist völlig verrückt. Wenn ich das tue, bin ich meinen Job los«, stöhnte sie.
Ich sah sie nur an und wartete. Die Orgelklänge aus der Kirche waren verstummt, und die Mütter mit den Kindern waren längst gegangen. Während sie angestrengt überlegte, kämpfte ich verzweifelt gegen die Bilder in meinem Kopf, ein zerwühltes Bett, meine Hände in ihrem wilden Haar. Shocking!
»Na schön«, sagte sie endlich und seufzte. »Aber nur, damit das klar ist: Kein S. Ich muss mich erholen. Emotionale Verwicklungen sind jetzt echt das Allerletzte, was ich gebrauchen kann.«
»Auf die Idee wäre ich niemals gekommen«, flüsterte ich und schluckte. »Ich bin schließlich ein echter britischer Gentleman.«
© 2014 Droemer Verlag.
Ich lief einfach los, ohne recht zu wissen, wohin. Ich hatte mehr Zeit für die Besprechung eingeplant, der TGV zurück nach Paris ging erst in zweieinhalb Stunden. Sicherlich wäre es ausgesprochen sinnvoll gewesen, eine Ausstellung oder ein Museum zu besuchen, schließlich war ich nie zuvor in Stuttgart gewesen, aber dann sprach mich die Architektur eines Cafés an, das direkt an eine große Kirche angrenzte.
Zögernd setzte ich einen Schritt hinein und blieb neben der Buchhandlung am Eingang stehen, schließlich spreche ich kein Deutsch. Aber dann wurde ich geradezu magisch hineingesogen von der langen Schlange an der Theke und stellte mich instinktiv an. Das Anstehen hatte etwas Beruhigendes, Vertrautes. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass wir Engländer im korrekten Schlangestehen nicht nur ausgesprochen qualifiziert sind, sondern es schon beinahe lieben. Es fällt uns schwer, an einer Schlange vorüberzugehen, selbst wenn sie uns überhaupt nicht betrifft.
Ich zeigte auf einen der appetitlich aussehenden Kuchen, Apfel, wie ich hoffte, dazu bestellte ich auf Englisch einen Kaffee.
»Was für einen Kaffee hätten Sie denn gern?«, antwortete die Bedienung in nahezu fehlerfreiem Englisch und deutete hinter sich an eine Tafel an der Wand. Ich habe den Eindruck, jeder spricht Englisch in diesem Land, es ist beeindruckend und ausgesprochen beschämend für uns. Ich blickte angestrengt auf die Tafel und verstand nichts außer Latte und Cappuccino. »America- no, please«, sagte ich schließlich.
»You Americano?«
»God, no! I'm English. Der Kaffee. Normaler Filterkaffee, bitte, das heißt bei uns Americano.«
Die Frau grinste, nickte, hantierte mit der Maschine, stellte Kaffee und Kuchen auf ein kleines Tablett und deutete auf Milch und Wassergläser neben der Kasse. Ich goss mir ein Glas Wasser ein und sah mich suchend um. In der Mitte des Raums standen die Tische in Reihen nebeneinander, dort gab es einen freien Platz, aber bei uns setzt man sich nicht zu Fremden, und neben der Gruppe junger Frauen mit kleinen Kindern, die kreuz und quer durcheinanderredeten, hätte ich mich auch reichlich deplatziert gefühlt. An einer Wand aus hellen Steinquadern, vermutlich die Kirchenwand, erspähte ich ein freies Stehtischchen mit zwei Barhockern links und rechts und balancierte das Tablett darauf zu, sehr besorgt, ich könnte über einen großen Hund stolpern, der im Weg lag.
So sah ich sie erst, als ich schon fast mit ihr zusammengestoßen war. Wir trafen vor dem Stehtisch aufeinander. Auch sie hielt ein Tablett in den Händen. Und dann blickte ich in diese Augen. Strahlende, smaragdgrüne Augen. Durch die Wand drang Orgelmusik, eine Nonne ging vorüber, und ich stand da wie angewurzelt, ließ beinahe das Tablett fallen, starrte vollkommen hilflos in diese göttlichen Augen und fühlte mich wie der größte Idiot auf Erden. Sie sah mich an, sehr ernsthaft und ein bisschen verwundert. Dann lächelte sie. Sie lächelte, und es war um mich geschehen, sofort. Innerhalb von Sekunden überrollte mich ein Tsunami. Ein Tsunami aus vollkommen überwältigenden, unbekannten Gefühlen, mit denen ich nicht das Geringste anfangen konnte. Ich meine, ich bin Engländer! Wir haben unsere Gefühle gern unter Kontrolle! Mir wurde ganz flau. Ich wollte etwas sagen, brachte aber nur ähnlich gutturale Laute heraus, wie ich sie von den Einheimischen gehört hatte. Ihr Lächeln verwandelte sich in ein Stirnrunzeln. Es war entsetzlich peinlich.
Ich habe die große Befürchtung, dass mein Leben nie wieder so sein wird wie zuvor, und ich bin nicht ganz sicher, ob ich damit klarkomme.
1. Kapitel
Das düstere Herrenhaus
Emma
Es ist einfach unfassbar. Also ehrlich, wofür halten sich die Ärzte heutzutage eigentlich? So schlecht geht es mir nun wirklich nicht. Die Magenschmerzen sind in letzter Zeit schlimmer geworden, das stimmt schon, aber mir deshalb einreden zu wollen, dass ich ein Magengeschwür kriege, wenn ich nicht aufpasse, das ist doch völlig übertrieben, davon bin ich ja nun wirklich weit entfernt. Reine Panikmache! Ich kenne meinen Körper schließlich besser als irgendein Betriebsarzt, der mich zwei-, dreimal gesehen hat und sich wichtigmachen will. Ich arbeite seit Jahren mit Stress, und mein Körper hat's immer ausgehalten. Und im Moment geht es nun mal besonders hektisch zu, das liegt am Projekt und wird sich auch wieder ändern. Ich muss weiter darum kämpfen, dass jemand eingestellt wird, der mir zuarbeitet.
Das dauernde Augenlidzucken ist lästig, weil man es sieht. Bis her hat mich aber noch niemand drauf angesprochen. Was man zum Glück nicht sieht, sind die Schlafstörungen. Die nerven wirklich. Deswegen bin ich ja auch zum Betriebsarzt. Die Firma leistet sich so was, immerhin. Ich wollte wirklich nur, dass er mir ein paar vernünftige Schlaftabletten verschreibt, mit möglichst viel Chemie drin, nicht so einen Baldriankram für esoterische Weicheier. Ich will einfach mal wieder am Stück durchpennen! Erst kann ich nicht einschlafen, obwohl ich hundemüde bin, und dann bin ich nach zwei Stunden wieder hellwach, und mir fällt irgendwas ein, was ich dringend erledigen muss. Ich versuche, nicht an die Arbeit zu denken, aber das geht nicht so einfach auf Knopfdruck, und je näher der Morgen rückt, desto öfter wache ich auf, manchmal habe ich fast das Gefühl, ich liege mehr wach, als dass ich schlafe, und bin beinahe froh, wenn der Wecker endlich klingelt und die Quälerei ein Ende hat. Ich fühle mich oft wie gerädert, aber mit starkem Kaffee, Guarana und Red Bull komme ich schon halbwegs durch den Tag. Außerdem habe ich so viel zu tun, dass ich keine Zeit habe, darüber nachzudenken, ob ich müde bin oder nicht.
Die Schwindelanfälle allerdings sind neu. Einmal bin ich sogar umgekippt. Zum Glück war ich grad allein, und keiner hat es mitgekriegt. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Ich hab mir den Arm an der Heizung angeschlagen, aber sonst ist weiter nichts passiert, und nachdem ich ein paar Gläser Wasser getrunken habe, konnte ich eigentlich fast normal weiterarbeiten. Vielleicht sollte ich mal ein Blutbild machen lassen. Ist bestimmt irgendein Vitaminmangel. Oder Eisen, das fehlt Frauen doch eigentlich immer.
Als der Arzt dann drauf bestand, meinen Blutdruck zu messen und ein EKG zu machen, nur wegen ein paar blöder Tabletten, die man nicht rezeptfrei kriegt, und schließlich mit Burn-out anfing, hab ich ihn zunächst völlig schockiert angestarrt. Zunächst. Dann fing ich an zu lachen. Weil, es ist einfach absolut lächerlich. Heutzutage ist doch alles Burn-out! Die Modekrankheit für alle Gelegenheiten! Sonst müsste man sich ja Gedanken über eine Diagnose machen. Außerdem, soweit ich weiß, ist Burn-out eine Form von Depression. Ich bin nicht depressiv. Nicht im Geringsten. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wir hatten mal einen Projektleiter, der hatte wirklich Burn-out. Der lag wochenlang nur im Bett und hat an die Decke gestarrt. Er kam dann wieder und hat kurz drauf gekündigt. Weil er den Termindruck nicht aushält, hat er gesagt, und ihm seine Gesundheit und seine Familie wichtiger ist. Aber ich, ich liege nicht im Bett! Ich mache meinen Job. Burn-out ist was für Versager.
»Ich schreibe Sie jetzt für zwei Wochen krank«, sagte der Arzt.
»Ich bin nicht krank!«, habe ich ihn angeschnauzt. »Und im Moment kann ich mir nicht einmal einen einzigen Tag Krankschreibung erlauben! Sie wissen genau, in welchem Projekt ich stecke, bis zum Hals, und welche Bedeutung es für uns hat!«
Er guckte mich sehr streng an und sagte scharf: »Ich sage Ihnen jetzt mal was. Wann haben Sie das letzte Mal in den Spiegel gesehen? Sie sehen aus wie ein Gespenst. Wenn Sie jetzt nicht die Notbremse ziehen, landen Sie in der Klinik. Und glauben Sie mir, das dauert dann viel, viel länger als nur zwei Wochen. Wenn Ihnen das lieber ist, dann machen Sie einfach so weiter.« Da wurde mir dann doch ein bisschen mulmig.
»Wie viel Stunden arbeiten Sie in der Woche?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. »Also, normalerweise allerhöchstens sechzig, in nächster Zeit wird's wohl ein bisschen mehr werden, wegen dem Projekt.« Er sah mich entgeistert an. »In fünf Tagen arbeiten Sie sechzig Stunden?«
»Nein. In sechs Tagen. Zehn Stunden am Tag, so wild ist das doch nicht, oder? Da hat man immer noch 14 Stunden am Tag für Essen, Schlafen, Facebook, Fernsehen und iPhone. Das ist mehr als die Hälfte! Und den kompletten Sonntag sowieso. Also, mir reicht das. Früher haben die Leute ja viel mehr gearbeitet. Da gab es den Begriff Freizeit gar nicht.« Und am Sonntagabend war ich meistens richtig froh, dass ich am nächsten Tag wieder arbeiten gehen konnte, aber das sagte ich ihm nicht.
»Und was machen Sie zur Erholung? Sport, Hobbys, Freunde treffen?«
»Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio in der Mittagspause«, log ich. »Und ich habe eine sehr gute Freundin, keine Sorge, und eine Kollegin, mit der ich mittags ab und zu essen gehe, ich habe keine Sozialphobie.« Okay, zu der Kollegin unterhielt ich mehr so eine strategische Beziehung, sie war die Sekretärin von einem der Chefs. Julia, die Freundin, war dafür echt. Sonntags war sie meist mit ihrer Familie beschäftigt, aber wir gingen mindestens einmal die Woche nach der Arbeit zusammen was trinken oder ins Kino. Der Arzt guckte mich immer noch total intensiv an. Langsam ging er mir auf die Nerven, mit seiner Nickelbrille und dem grauen Haar. Bestimmt hatte ihm die Pharmaindustrie ein teures Wochenende im Luxushotel finanziert, »Früherkennung von Burnout «, und jetzt sollte er als kleinen Dank ein paar Medikamente ausprobieren. Oder machte er einen auf Apotheken-Umschau, »Ich bin Arzt - mit Gewissen!«. Er schob mir dann die Krankschreibung über den Tisch und lehnte sich zu mir herüber.
»Hören Sie«, sagte er leise und eindringlich, so, als hätte er die Befürchtung, dass irgendjemand heimlich mithörte. Dabei war die Tür zu. Der Mann litt unter Verfolgungswahn, ganz klar. »Ich rate Ihnen: Klinken Sie sich zwei Wochen aus. Machen Sie Spaziergänge an den Bärenseen. Legen Sie sich im Mineralbad Leuze in die Sauna. Schlafen Sie sich aus. Wenn Sie hier zusammenklappen, keiner wird es Ihnen danken. Irgendwann fliegen Sie unter einem Vorwand raus. Dann macht jemand anders Ihren Job. Niemand ist unersetzlich. Vor allem, wenn das Projekt doch noch kippt ...«
Als ob ich das nicht wüsste! Das Gesülze hätt er sich echt sparen können. Ich weiß, dass es genug Leute gibt, die mich gern abschießen würden. In einer Männerdomäne arbeitet man doppelt so hart wie die Kerls. Trotzdem: Ich mache meinen Job, weil ich ihn gern mache. Vielleicht auch ein klitzekleines bisschen, um den Männern zu beweisen, dass ich in einem Männerjob meine Frau stehe, aber das ist nicht der Hauptgrund. Arbeit ist nun mal das Wichtigste im Leben, und ich habe das Riesenglück, dass ich einen Job habe, der wirklich toll ist. Aber das kann sich so ein armseliger Betriebsarzt, der es bestimmt kaum erwarten kann, in Rente zu gehen, natürlich nicht vorstellen. Trotzdem steckte ich die Krankmeldung ein.
Ich blieb einen Moment im Flur stehen und holte tief Luft. Erst jetzt merkte ich, dass er mir kein Schlaftablettenrezept gegeben hatte, der Arsch. Ich war kurz davor, wütend gegen seine Tür zu hämmern. Dreh jetzt nicht durch, Emma, beschwor ich mich selber. Schlaf dich ein, zwei Tage aus, dann kommst du wieder und machst einen auf Superheldin, die sich trotz Krankheit pflichtbewusst zur Arbeit schleppt. Ich ging zurück in mein Büro, setzte mich an meinen Schreibtisch und checkte meinen Posteingang. Eine Erinnerung, elf neue Mails, zwei davon waren mit »Wichtigkeit - hoch« gekennzeichnet. Um mich herum war alles verlassen. Mittagspause. Die Chefs saßen beim Edelitaliener in der Türlenstraße und hatten mich eigentlich dabeihaben wollen, damit ich sie zwischen Antipasti und Tiramisu über den Stand des Projekts informierte. Ich hatte einen seit Tagen vereinbarten Telefontermin vorgeschoben und versprochen, so schnell wie möglich nachzukommen. Ich stand auf und starrte durch die riesigen Glasfenster hinaus auf die Baustelle. Im Sonnenschein sah sie nicht so schlimm aus wie sonst. Mein Telefon klingelte. Wenn ich jetzt einfach ohne Erklärung verschwand, würden die wildesten Spekulationen ins Kraut schießen. Schwangerschaft bestimmt nicht, weil »Die will doch sowieso koinr«, aber was Psychisches, sofort. Am besten kurz aufs Handy anrufen, Migräne vortäuschen. Aber bei Migräne würden sie sich das Maul zerreißen, ist doch typisch, Frauen sind halt nicht belastbar, und wenn's wirklich drauf ankommt, kriegen sie Migräne, und wer kümmert sich jetzt ums Projekt? Darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Und für Migräne kriegte man auch keine Krankschreibung über zwei Wochen. Blieb die Variante: ehrlich sein. Ach, übrigens, ich wollte nur kurz Bescheid geben, ich bin krankgeschrieben, Burn-out- Gefahr, ist aber nicht weiter dramatisch. Da konnte ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln! Ganz nach oben auf die Abschussliste! Plötzlich war mir alles egal. Ich war niemandem eine Erklärung schuldig. Ich sagte meine Teilnahme für die Besprechung am Nachmittag ab, schickte eine Mail an alle drei Chefs und an Petra vom Personal, dass ich für zwei Wochen krankgeschrieben war, aber nicht vorhatte, die volle Zeit in Anspruch zu nehmen, stellte das Diensthandy ab und ließ es deutlich sichtbar auf dem Schreibtisch liegen. Dann schickte ich Julia eine kurze Nachricht, aber die war sowieso mit der Familie in Urlaub. Die letzte Mail schickte ich an Melli und löschte dann die privaten Mails aus dem »Gesendet«-Ordner. Für alle Fälle, denn ich traute hier niemandem. Ich fuhr den PC herunter und stellte das Telefon um. Es klingelte wieder, und auf dem Display erschien eine Handynummer. Die Chefs hatten meine Mail gelesen. Ich packte hastig meine Sachen zusammen, stopfte die Krankmeldung in einen Umschlag, warf sie beim Hinausgehen in Petras Postkörbchen und machte, dass ich zur Tür rauskam. Petra konnte mich noch nie leiden.
Der Pförtner winkte mir erstaunt zu, als ich das Gebäude verließ. Er sah mich sonst nur morgens, es sei denn, ich hatte einen Termin außer Haus oder musste zur Baustelle. Meist kamen die Termine jedoch zu mir. Wenn ich abends ging, war der Pförtner normalerweise seit Stunden im Feierabend. Mittags ging ich nur selten vor die Tür, aß meist am Schreibtisch ein belegtes Brot und arbeitete dabei weiter. Jetzt lief ich einfach los, ohne recht zu wissen, wohin. Es gab sowieso nur eine Richtung, in die man vernünftig gehen konnte, am Hauptbahnhof vorbei in die Königstraße. Weit war das nicht, aber es dauerte, weil ich wegen der vielen Baustellen überall Umwege laufen musste. Die Königstraße war total voll. Meine Güte, wie viele Leute in meinem Alter es gab, die mittags mit Einkaufstüten in der Hand über die Königstraße schlenderten, schon am Anfang der Woche, als hätten sie nichts zu tun! Von was lebten die? Hatten die keinen Job? Aber wieso konnten die sich dann einen Stadtbummel leisten? Ich war seit Monaten nicht in der Innenstadt gewesen, schon gar nicht tagsüber. Normalerweise kaufte ich abends auf den letzten Drücker beim Gemüsetürken ein. Ich fühlte mich ein bisschen verloren, fast so, als würde man mir ansehen, dass ich eigentlich kein Recht hatte, hier zu sein. Dass ich eigentlich an meinem Schreibtisch sitzen müsste, Telefonate führen, Mails schreiben, Besprechungen moderieren, am besten alles gleichzeitig. An meinem Schreibtisch fühlte ich mich sicher. Dort war mein eigentliches Zuhause.
Obwohl ich keine Eile hatte, war ich von ganz alleine in meinen üblichen Stechschritt gefallen. Ich laufe nie langsam, man verliert zu viel Zeit dabei, und das entspricht mir nicht. Kaffee, sagte ich mir. Du solltest ganz entspannt einen Kaffee trinken gehen, wie eine Art Übergangsritual, und damit deine zwei freien Tage einläuten. Wenn du jetzt nach Hause gehst, weißt du sowieso nichts mit dir anzufangen. Da ich gerade auf der Höhe des Hauses der Katholischen Kirche war, das ein Café beherbergt, ging ich hinein.
Ich stellte mich in die Schlange und holte mir einen Milchkaffee und nach kurzem Kampf mit mir selbst ein Stück Käsekuchen. Auch hier war es voll. Offensichtlich gab es zu viele Menschen, die genug Zeit und Geld hatten, um unter der Woche entspannt in einem Café abzuhängen, so, als gäbe es keine Arbeit, keine Pflichten, kein Morgen. Zielstrebig steuerte ich einen freien Stehtisch an. Von der anderen Seite näherte sich ein Typ, der es offensichtlich auf den gleichen Tisch abgesehen hatte, und ich dachte nur: Junge, leg dich bloß nicht mit mir an. Ich bin extrem schlecht gelaunt, das ist mein Platz, und ich habe nicht vor, ihn mit dir zu teilen, auch wenn da zwei Hocker sind, ist das klar? Der Mann blieb stehen und starrte mich an, als sei ich eine Erscheinung. Irgendetwas an ihm rührte mich. Vielleicht, dass er ein bisschen tollpatschig wirkte, wie er da mit seinem Tablett in der Hand beinahe über einen Hund stolperte. Außerdem sah er trotz seines zerzauselten Haars und des Cordjacketts, das von meinem Großvater hätte stammen können, ziemlich attraktiv aus. Groß, schlank, fast schlaksig. Nicht, dass er mich besonders beeindruckte, Männer wurden völlig überbewertet, aber schon fast gegen meinen Willen musste ich grinsen.
Er kam zögernd näher. Dann gab er ein paar ziemlich seltsame Geräusche von sich, und für einen Moment dachte ich, er sei durchgeknallt. »Good afternoon«, sagte er endlich mit einem sehr britischen Akzent. Mehr nicht. Er stand da und starrte mich an, und ich dachte nur, ein blöder Brite, ausgerechnet. Ich mag keine Briten! Amis, ja, ich war mal ein Jahr an einer amerikanischen Highschool, aber keine Briten. Er fragte nicht, ob er den freien Stuhl haben könnte. Er stand nur da und sah schräg nach unten, so, als säße unter dem Tisch ein wildes Tier, vor dem er sich fürchtete. Ich saß schon auf meinem Stuhl, das Tablett vor mir. »Sit down«, sagte ich knapp. Das reichte ja wohl. Ich hatte nicht vor, mich mit ihm zu unterhalten. Er gehorchte und starrte mich wieder an.
»Thank you«, sagte er. »Thank you very much indeed. That's very kind. Lovely day, isn't it?«
Ich stöhnte innerlich. Halt bloß die Klappe, dachte ich. Ich hab dir einen Stuhl angeboten. Das reicht doch wohl, oder? Ich will kein Gespräch mit dir anfangen, schon gar nicht, wenn du so ein blasiertes England-Englisch redest und mit Höflichkeitsformeln um dich schmeißt. Ich will in aller Ruhe darüber nachdenken, wie beschissen das Leben ist. Und schon gar nicht will ich mit dir übers Wetter reden. Wir sind in Stuttgart, es ist Juni, der Sommer hat angefangen, es ist grauenhaft schwül, wahrscheinlich wird's noch gewittern, und es ist mir scheißegal, weil die Sommer in Stuttgart jedes Jahr so sind. Noch immer sah er mich an und lächelte erwartungsvoll, ganz so, als würde es ihm nichts ausmachen, fünf oder zehn Minuten oder gar eine Stunde auf meine Antwort zu warten.
»No, it's not a lovely day«, sagte ich schließlich, so unfreundlich ich nur konnte, und deutlich lauter, als es nötig gewesen wäre, senkte den Blick wütend auf meine Kaffeetasse und hoffte, ihn damit endgültig zum Schweigen gebracht zu haben.
»Oh«, entgegnete er schließlich. Ich sah nicht auf.
Und dann, noch einmal, »Oh«. Dann sagte er nichts mehr. Na also. Ich schielte auf seine Tasse. Er rührte darin herum und trank noch immer nicht. Hurra, dachte ich erleichtert. Er hat's kapiert. Vorsichtig guckte ich hoch. Er sah mich an. »I'm sorry«, sagte er, ganz leise, und in seinem Blick lag so viel Anteilnahme und Wärme, dass etwas in mir platzte, und plötzlich, ganz gegen meinen Willen, brach ich in Tränen aus.
Emma
Der Flughafen in Newquay war winzig. Zu winzig offensichtlich für Gepäck. Mein Koffer war jedenfalls nicht im Flieger, sondern bei meinem Zwischenstopp auf dem Flughafen London-Gatwick hängengeblieben.
»I'm sorry«, sagte Nicholas, als sei es seine Schuld. Er füllte beim Lost & Found das Formular für mich aus, gab seine Handynummer an und betonte mehrmals, man möge den Koffer sofort bringen lassen, wenn das nächste Flugzeug aus London kam. Ich war es nicht gewohnt, dass jemand etwas für mich erledigte. Es war mir total unangenehm.
Ich bin kein Mensch, der leicht ins Schwärmen gerät, aber der Landeanflug war unglaublich gewesen. Ich hatte einen Fensterplatz, das Wetter war fantastisch, die Sonne ging gerade glutrot unter, und wir flogen das letzte Stück entlang der Küstenlinie, erst waren da schroffe Felsen und dann ein endloser, nahezu menschenleerer Sandstrand, und Schaumkronen auf dem Meer, und ein paar schwarze Punkte, die im Wasser tanzten, wahrscheinlich Surfer. Das war also Cornwall.
Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt, man hätte fast meinen können, man sei irgendwo im Süden, am Mittelmeer. Ich blickte hinaus, war völlig fasziniert, und plötzlich war da dieses komische Gefühl. Normalerweise ignoriere ich meine Gefühle, aber jetzt überrollte mich eine Welle, sie riss mich mit sich, und ich war ihr hilflos ausgeliefert. Es fühlte sich an wie eine Traurigkeit, oder wie die Sehnsucht, die mich manchmal an einem der ersten warmen Abende im Frühling überkam, wenn die Natur explodierte und die Vögel sangen wie verrückt. Ich weiß nicht genau, was es war, und ich wollte es auch gar nicht wissen, es war fast wie ein Schmerz und fühlte sich so unangenehm an, dass ich es sofort wegschob. Gefühle konnte ich jetzt echt nicht brauchen. Ich wollte mich erholen! Zurück blieb eine leichte Unruhe. Ich bin eigentlich nicht so der nervöse Typ, aber ich konnte es immer noch nicht fassen, dass ich einfach abgehauen war. Ohne irgendjemandem was zu sagen außer Melli, Julia, meiner Mutter, dem Aboservice der Stuttgarter Zeitung und meiner Nachbarin, mit der ich die Kehrwoche getauscht hatte, falls ich je bis Samstag nicht zurück war. Bloß nicht drüber nachdenken, wie verrückt das war! Genauso verrückt wie die Tatsache, dass ich mich mit einem Mann treffen würde, den ich überhaupt nicht kannte. Nicht nur treffen, sondern sogar bei ihm wohnen! Das konnte ja ganz schnell saumäßig peinlich werden. Es war dann aber völlig cool. Nicholas gab mir höflich die Hand und lächelte, sehr freundlich und sehr distanziert. Bei dem muss man sich echt keine Sorgen machen, dass er nachts über einen herfällt! Wahrscheinlich ist er schwul und hat mich nur eingeladen, weil er Mitleid mit mir hatte, im Café, als ich anfing zu heulen. Männer sind ja immer total beeindruckt, wenn Frauen heulen. Viele Frauen flennen absichtlich, wenn sie was erreichen wollen. Ich nicht. Ich find's vor allem peinlich.
Als wir zum Auto gingen, das einzige, das noch auf dem Parkplatz stand, wegen der Koffergeschichte, zog sich der Himmel plötzlich mit schwarzen Wolken zu, in Sekundenschnelle, wie mir schien. Die ersten Tropfen fielen, und ich rannte die letzten Meter zum Auto, weil meine Jacke war ja im Koffer, und ich trug nur ein dünnes Sommerkleid, das blöderweise auch noch den Fettring auf meinen Hüften betonte, und wenn's nass wurde, erst recht. Nicholas trat neben mich und sagte todernst: »Willst du fahren?«, und erst da merkte ich, dass ich auf der Fahrerseite stand. Kaum saßen wir im Auto, fing es an, wie aus Kübeln zu schütten.
»He, grad eben hat doch noch die Sonne geschienen!«, protestierte ich.
Nicholas lachte. »Es tut mir wirklich leid, aber plötzliche Wetterumschwünge sind hier ziemlich normal. Du solltest immer etwas gegen den Regen dabeihaben, selbst wenn keine Wolke am Himmel ist. Wenn es regnet, wird es auch ziemlich schnell kalt, du solltest also auch immer etwas Warmes dabeihaben. Da der Regen oft von Sturmböen begleitet wird, vor allem, wenn er überraschend vom Meer her kommt, solltest du immer auch etwas gegen den Wind dabeihaben. Am besten hast du immer alles dabei. Auch Badesachen, denn es könnte auch ganz plötzlich wieder aufklaren.«
Na großartig, dachte ich. Ich trage Sommerklamotten, weil ich dachte, ich mache Sommerurlaub, es schüttet, und mein Koffer hängt in London, und selbst in diesem Koffer befindet sich nur eine sehr überschaubare Anzahl von Klamotten gegen Regen, Kälte und Wind, weil ich ja dachte, ich mache Sommerurlaub. Immerhin hatte Nicholas Badesachen erwähnt. »Wie viel Grad hat das Wasser denn so?«
»Ach, im Juni in der Regel so um die 16 Grad.«
Das waren nur vier Grad weniger als die Kaltbadehalle im Leuze und klang nach einem fantastischen Badeurlaub. Am besten sollte ich wohl auch immer eine Wollmütze dabeihaben.
»Dieses Jahr allerdings war das Frühjahr so kalt, da hat es wohl nur 14 Grad, schätze ich«, fuhr Nicholas erbarmungslos fort. »Entschuldige bitte das Auto. Es gehörte meinem Vater und ist etwas klapprig.« Das war eine ziemliche Untertreibung. Die Karre quietschte und ächzte, auf meiner Seite regnete es herein, weil das Fenster nicht richtig zuging, und es roch penetrant nach Pferd und Hund. »Wie lange brauchen wir ungefähr?«, fragte ich.
»Normalerweise nicht einmal eine halbe Stunde. Aber bei dem Wetter ...« Nicholas starrte angestrengt auf die Straße. Es schüttete jetzt so stark, dass er nur langsam fahren konnte. Außerdem war es ganz schnell zappenduster geworden. »Ich hoffe sehr, du verzeihst mir, dass ich mich für die Dauer der Fahrt nicht mit dir unterhalte«, sagte Nicholas. »Aber ich bin leider etwas aus der Übung und muss mich auf das Fahren konzentrieren. In Paris hatte ich kein Auto.«
»Aber natürlich verzeihe ich dir«, sagte ich und versuchte nachzurechnen, wie oft Nicholas sich schon entschuldigt hatte, seit ich angekommen war. Er redete auch immer so gestelzt. Wie aus einem Film entsprungen, Stolz und Vorurteil oder so. Wahrscheinlich waren die Engländer einfach förmlicher als die Amis. Wir fuhren schweigend durch den prasselnden Regen. Es ging ziemlich viel rauf und runter und um irgendwelche Kurven, aber erkennen konnte ich praktisch nichts.
Irgendwann krachten wir beinahe in ein Gatter. »Bloody hell!«, entfuhr es Nicholas, um sich gleich darauf wieder wortreich zu entschuldigen, dabei machte ihn das Fluchen direkt mal etwas weniger distanziert. Er setzte ein Stück zurück, sprang hinaus in den Regen und machte sich an dem Gatter zu schaffen. Es schwang von alleine auf, während er zurück zum Auto rannte. Kies knirschte unter den Reifen. Hatte das Häusle etwa eine private Zufahrt? Beleuchtung gab es keine. Ich erkannte nur ein paar hohe Bäume, dann fuhr Nicholas um eine Kurve und hielt an. »Da sind wir«, sagte er feierlich. »Herzlich willkommen in Fox Hall.« Fox Hall? Ich stieg aus und stand vor meinem leicht frustriert wirkenden Gastgeber, der wie ein Hase ums Auto herumgerannt war, um mir die Wagentür zu öffnen. Äh - was hatte er gesagt? »Das Haus ist nicht unbedingt klein.« Okay, was stellt man sich da so vor? Ein etwas größeres Einfamilienhaus, vielleicht? Mit ein bisschen Gärtle drum rum und einer Garage, möglicherweise sogar einer Doppelgarage, so, wie man im Remstal gerne wohnte? Es lebe das britische Understatement! Auch wenn ich in der Dunkelheit und dem strömenden Regen nicht viel erkennen konnte - hier stand ich, fernab jeglicher Zivilisation, vor einem gigantischen, düsteren Schuppen, der offensichtlich schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hatte. Eine große Freitreppe führte hinauf zum Eingang, der sich hinter einer Reihe vorgesetzter Säulen verbarg. Ich stand nur da und starrte.
»Komm«, sagte Nicholas neben mir sanft. »Du wirst ja ganz nass.« Plötzlich lief mir ein Schauer über den Rücken.
Nicholas
Emma schläft jetzt seit gut zehn Stunden. Die Arme scheint furchtbar erschöpft zu sein. Vor einer guten Stunde stand ich an ihrer Zimmertür und lauschte; nicht das leiseste Geräusch war zu hören. Nun, das ist ein gutes Zeichen. Schließlich ist sie her gekommen, um sich zu erholen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie hier ist! Was ich am allerwenigsten fassen kann, ist, dass ich es gewagt habe, sie nach Fox Hall einzuladen. Normalerweise bin ich entsetzlich schüchtern, wenn es um Frauen geht, aber Emma löst weiterhin die erstaunlichsten Gefühle in mir aus. Als sie mir gestern auf dem Flughafen entgegenkam, in diesem entzückenden Sommerkleid, das so hübsch auf ihren Hüften lag, verspürte ich den völlig irrationalen Wunsch, auf sie zuzurennen, sie in meine Arme zu reißen und bis zur Besinnungslosigkeit zu küssen. Mir brach am ganzen Körper der Schweiß aus, aber in Eton habe ich Selbstbeherrschung gelernt, und ich hoffe sehr, sie hat es nicht gemerkt. Eigentlich sollte ich über meinen Papieren sitzen, aber ich bin zu nervös. Außerdem ärgere ich mich über den Earl. Bestimmt ist er eifersüchtig und hat deswegen das Tor zugemacht. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit ihm reden müssen, aber er lässt sich nicht blicken. Ich muss unter allen Umständen verhindern, dass Emma den Earl kennenlernt.
Ich werde mit den Frühstücksvorbereitungen beginnen, das wird mich beruhigen. Irgendwann wird Emma ja aufstehen und sicher schrecklichen Hunger haben; gestern Abend war sie völlig entkräftet und wollte gleich zu Bett gehen. Ich lobe mich selber nur ungern, aber mein Full English Breakfast gehört mit zum Besten, was man in Cornwall in Sachen Frühstück bekommen kann. Das liegt bei uns in der Tradition der Familie, und zwar in der männlichen Linie. Das Frühstück meines Vaters war legendär. Sollte ich einmal einen Sohn haben, wonach es im Augenblick nicht aussieht, so hoffe ich, dass er sich ebenfalls für die Kunst des Frühstückmachens interessiert. Der einzige Unterschied zwischen dem Full English Breakfast meines Vaters und meinem Full English Breakfast besteht darin, dass ich die Würstchen weglasse. Und den Black Pudding. Für manche Leute ist es dann nicht mehr wirklich full. Aber Emma achtet sicher auf ihre Linie und legt keinen Wert auf fettige Würstchen und gebackenes Schweineblut. Nicht, dass sie es sich nicht erlauben könnte, so fantastisch, wie sie aussieht. Dabei könnte ich nicht einmal genau sagen, was es ist, was sie so fantastisch macht. Ich meine, als ich sie zum ersten Mal in dem Café in Stuttgart sah, trug sie einen ziemlich langweiligen schwarzen Hosenanzug, wie ihn Hunderte von Frauen im Londoner Bankenviertel tragen. Und doch hätte ich sie niemals für eine Engländerin gehalten. Zum einen ist sie nicht so ein Hungerhaken wie viele Businessfrauen in London, die meinen, sie müssten in die gleiche Kleidergröße passen wie unsere magersüchtige Herzogin. Nein, sie hat Rundungen, aber die Rundungen sind auch nicht zu rund und genau da, wo sie hingehören. Sie wirkte insgesamt sehr gepflegt und war auch eher dezent geschminkt, während sich viele Engländerinnen mit Make-up zukleistern, weil sie sich zu häufig betrinken und Alkohol im Gesicht seine Spuren hinterlässt und sie trug flache Pumps, nicht so hochhackige Schuhe, in denen die Engländerinnen selbst bei Schnee ohne Seidenstrümpfe herumwackeln, weil sich die Anschaffung der Schuhe nicht lohnen würde, wenn sie auf gutes Wetter warteten.
Ich schätze jedoch, das Beste an Emma sind ihre Haare. Obwohl sie sich offensichtlich große Mühe gibt, sehr ordentlich auszusehen, scheinen die Haare nicht ordentlich sein zu wollen. Sie sind kurz und blond und wuschelig und stehen ziemlich wild in alle Richtungen ab. Die Haare erinnern mich sogar fast ein bisschen an Meg Ryan in Stadt der Engel. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn bestimmt schon neunmal gesehen, immer alleine, und jedes Mal heule ich am Ende, wenn Meggie, frisch vom Lkw überfahren, in den Armen von Seth stirbt, obwohl das mit dem Heulen natürlich ausgesprochen unmännlich ist. Deswegen würde ich den Film auch niemals in Begleitung anschauen. Dann würde es heißen, ich sei schwul. Ich könnte mich nirgends mehr blicken lassen, vor allem nicht im Pub. Im Pub muss ein Mann ein echter Mann sein, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, an das auch ich mich halte.
Emma brach in Stuttgart im Café ebenfalls in Tränen aus. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie normalerweise nicht weint. Es war ihr nämlich offensichtlich schrecklich peinlich. Mir war es auch schrecklich peinlich, aber ich ließ es mir nicht anmerken und wartete einfach ab.
»Ich habe ein Problem«, flüsterte sie schließlich. »Houston, we've got a problem«, dachte ich automatisch. Ihr Englisch war sehr amerikanisch, ansonsten aber hervorragend.
»Das tut mir ausgesprochen leid«, sagte ich, so höflich ich nur konnte. Höflichkeit ist das beste Mittel, wenn Leute dabei sind, die Nerven zu verlieren. Ich wollte auf keinen Fall, dass dieses entzückende Wesen die Nerven verlor, aus dem Café stürzte und ich es nie mehr wiedersah. »Wenn Sie mir gerne sagen möchten, worum es in diesem Problem geht, obwohl man ehrlicherweise zugeben muss, dass wir uns im Prinzip überhaupt nicht kennen, dann würde ich das nicht seltsam finden. Ich heiße übrigens Nicholas. «
»Emma«, flüsterte sie. »Burn-out.«
»Emma. Was für ein hübscher Name. Burn-out. Wie ausgesprochen interessant.«
»Interessant?«, rief sie und schien verärgert zu sein.
»Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was Burn-out ist«, sagte ich entschuldigend.
»Das ist Englisch!«, rief sie aus.
»Das dachte ich mir. ›Handy‹ scheint auch Englisch zu sein. Trotzdem versteht es bei uns niemand. Wir sagen ›Mobile phone‹.«
»Ach«, murmelte sie und schwieg. Immerhin schien sie sich ein wenig gefangen zu haben.
»Ich arbeite für ein großes Ingenieursbüro«, sagte sie schließlich. »Ich koordiniere ein Projekt. Ein sehr kompliziertes Projekt. Es ist ein Projekt, das die Stadt komplett revolutionieren wird, eine Wahnsinns-Chance für die Zukunft. Der Bahnhof wird unter die Erde gelegt. Das spart Fahrzeit, schafft eine faszinierende neue Infrastruktur. An unser Büro sind einige der zentralen Bauvorhaben vergeben worden.«
Sie klang jetzt so, als träte sie im Fernsehen bei einer Talkshow auf. Ich muss sagen, ich war beeindruckt.
»Leider ist es auch ein Projekt, bei dem ständig was schiefgeht. Ich bin für einen Teilbereich verantwortlich. Bei mir laufen alle Fäden zusammen. Ich überwache den Stand der Bauarbeiten, die Termine, das Geld. Es ist ein Traum- und ein Horrorjob gleichzeitig. Ich arbeite wie eine Verrückte, aber es geht unheimlich viel schief. Alle wissen, dass der Zeitplan ein völliger Wahnsinn ist. Niemand hält die Termine ein, weil sie gar nicht zu halten sind, und ich bin diejenige, die es ausbadet. Und das Geld ist viel zu knapp kalkuliert. Außerdem haben wir nicht genug gute Leute. Ich schlafe kaum noch. Der Arzt sagt, ich sei krank, und kriege Burn-out. Das ist eine Erschöpfungskrankheit. Wenn es jemanden wirklich schlimm erwischt, fällt er Monate aus. Das kann ich mir nicht leisten. Er hat mich krankgeschrieben, für zwei Wochen. Deswegen sitz ich jetzt hier und nicht in meinem Büro. Ich hab vor, zwei Tage daheimzubleiben, und dann gehe ich wieder arbeiten.« Sie hatte geredet ohne Punkt und Komma. Wir schwiegen beide.
»Komm mit mir nach Cornwall«, platzte ich heraus und wimmerte gleichzeitig innerlich, fabelhaft, Nicholas, das hast du ja wirklich geschickt eingefädelt.
»Wie bitte?«
»Ich fahre in zwei Stunden mit dem TGV nach Paris und hole meine Koffer ab, ich habe dort gelebt, dann geht's gleich weiter nach London und Cornwall. Ich habe ein Haus geerbt. Mein Vater ist kürzlich verstorben. Das Haus ist nicht gerade im besten Zustand, das solltest du wissen, aber es ist nicht unbedingt klein. Ich muss mich darum kümmern und werde nicht allzu viel Zeit haben, aber ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass Cornwall ein ausgesprochen geeigneter Ort ist, um sich zu erholen. Man kann sehr schön auf dem Küstenpfad spazieren gehen, die Luft ist gut, und die Menschen sind sehr freundlich.« Während ich das sagte, genauso ohne Punkt und Komma wie Emma, tobte ein hässliches kleines Männlein durch meinen Kopf und schrie: »Du bist völlig verrückt, Nicholas! Du kennst diese Frau überhaupt nicht! Dein Haus ist die größte Bruchbude an der ganzen Nordküste! Du bist pleite! Was, wenn es zwei Wochen am Stück stürmt? Es regnet durchs Dach, und man hat dir die Heizung abgestellt! Meinst du, es ist so eine Art Schicksal, dass du diese Frau getroffen hast? Sie passt überhaupt nicht zu dir!«
Felicity hatte immer gesagt, ich sei ein hoffnungsloser Romantiker.
Während das Männlein in mir tobte und ich nach außen krampfhaft weiterlächelte, sah Emma mich ungläubig an. Und dann lachte sie. Es brach aus ihr heraus, vollkommen ungekünstelt, sehr vergnügt, erstaunlich laut und schon fast ein bisschen ordinär. Für uns in England, jedenfalls, wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Es haute mich um. Es fühlte sich an, als sei ich gerade gegen einen Pfosten gerannt und hätte für ein paar Sekunden das Bewusstsein verloren. Sie musste es mir angesehen haben, denn sie fragte mich, ob alles okay sei. Ich schluckte und sagte hastig: »Natürlich. Alles okay.« Aber nach diesem Lachen wusste ich: Ich hatte genau das Richtige getan.
»Cornwall«, sagte sie. »Aha. So Rosamunde-Pilcher-mäßig?«
»Rosamunde wer?«
»Nicht so wichtig. Und du lädst mich also ein, obwohl du mich überhaupt nicht kennst? Du weißt doch gar nicht, ob ich dir auf die Nerven gehe! Und ich soll in zwei Stunden in einen Zug steigen? «
»Es gibt genügend Platz, und du wirst dich sowieso überwiegend selber beschäftigen müssen. Und natürlich sollst du nicht in zwei Stunden in einen Zug steigen, sondern mit dem Flugzeug nachkommen, morgen vielleicht. Du könntest nach Newquay fliegen, das ist nicht weit. Dort könnte ich dich abholen.«
»Das ist völlig verrückt. Wenn ich das tue, bin ich meinen Job los«, stöhnte sie.
Ich sah sie nur an und wartete. Die Orgelklänge aus der Kirche waren verstummt, und die Mütter mit den Kindern waren längst gegangen. Während sie angestrengt überlegte, kämpfte ich verzweifelt gegen die Bilder in meinem Kopf, ein zerwühltes Bett, meine Hände in ihrem wilden Haar. Shocking!
»Na schön«, sagte sie endlich und seufzte. »Aber nur, damit das klar ist: Kein S. Ich muss mich erholen. Emotionale Verwicklungen sind jetzt echt das Allerletzte, was ich gebrauchen kann.«
»Auf die Idee wäre ich niemals gekommen«, flüsterte ich und schluckte. »Ich bin schließlich ein echter britischer Gentleman.«
© 2014 Droemer Verlag.
... weniger
Autoren-Porträt von Elisabeth Kabatek
Elisabeth Kabatek, geb. 1966 in Stuttgart, ist in Gerlingen bei Stuttgart aufgewachsen. Sie studierte Anglistik, Romanistik, Politikwissenschaft und Theologie in Heidelberg, Salamanca und Granada. Weitere Auslandsaufenthalte in England und Paris, Reisen nach Lateinamerika, Afrika und Asien schlossen sich an. Seit 1999 ist sie Abteilungsleiterin für Fremdsprachen, Deutsch als Fremdsprache, Kleinkunst, Literatur, Kunstgeschichte und Frauenbildung an der Volkshochschule Ostfildern.
Bibliographische Angaben
- Autor: Elisabeth Kabatek
- 2014, 352 Seiten, Masse: 12,5 x 21,5 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Droemer/Knaur
- ISBN-10: 3426226413
- ISBN-13: 9783426226414
- Erscheinungsdatum: 14.01.2014
Rezension zu „Ein Häusle in Cornwall “
"Elisabeth Kabatek schreibt sehr erfolgreich Romane über tollpatschige Heldinnen, die herzallerliebst durch die Männer- und Berufswelt stolpern. Sehr amüsant!" -- freundinDONNA, 15.01.2014"Einfach witzig, dieser Mix aus Rosamunde-Pilcher-Idyll und Schwabenmentalität." -- FürSie, 06.01.2014
Kommentare zu "Ein Häusle in Cornwall"
0 Gebrauchte Artikel zu „Ein Häusle in Cornwall“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|

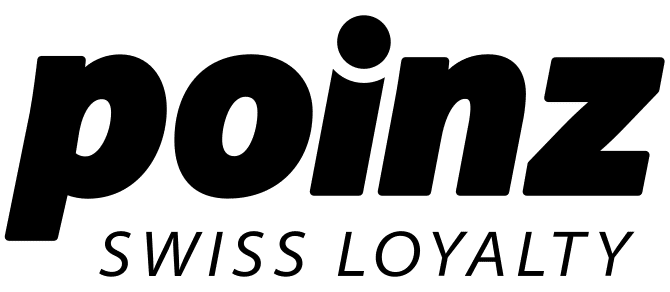



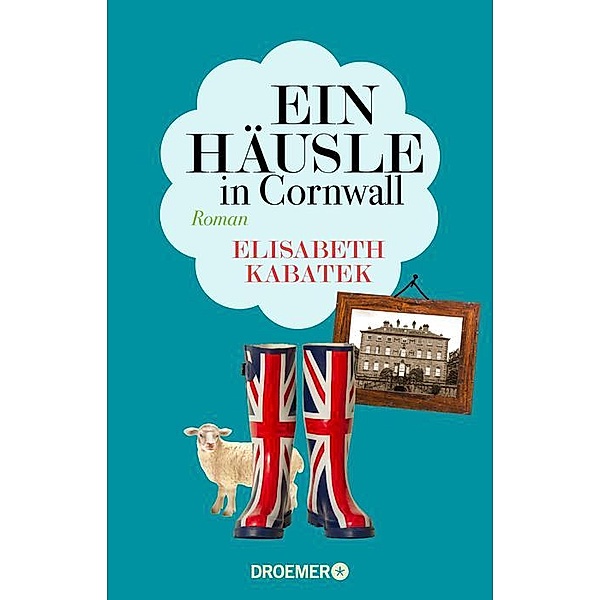

5 von 5 Sternen
5 Sterne 5Schreiben Sie einen Kommentar zu "Ein Häusle in Cornwall".
Kommentar verfassen